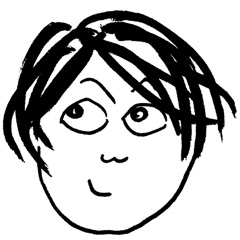...




Menschen wie alle anderen
Ein Comic über antisemitische Bilder und ihre Wirkung
Ein Comic-Projekt basierend auf der Sammlung antisemitischer Bilder und Objekte von Arthur Langerman
Die Sammlung von Arthur Langerman enthält über 11000 visuelle Antisemitika aus vier Jahrhunderten und beinahe allen europäischen Ländern. Als illustriertes Archiv der Geschichte der Judenfeindschaft stellt es einen weltweit einzigartigen Quellenfundus dar. Das Arthur Langerman Archiv für die Erforschung des visuellen Antisemitismus (ALAVA) betreut die umfangreiche Sammlung. Es wird von der Technischen Universität Berlin verwaltet und hat seinen Sitz am Zentrum für Antisemitismusforschung.
ALAVA hat Nathalie Frank mit der Entwicklung eines Konzepts sowie der künstlerischen Umsetzung einer Graphic History zu visuellem Antisemitismus beauftragt.
Ein Comic über antisemitische Bilder und ihre Wirkung
Ein Comic-Projekt basierend auf der Sammlung antisemitischer Bilder und Objekte von Arthur Langerman
Die Sammlung von Arthur Langerman enthält über 11000 visuelle Antisemitika aus vier Jahrhunderten und beinahe allen europäischen Ländern. Als illustriertes Archiv der Geschichte der Judenfeindschaft stellt es einen weltweit einzigartigen Quellenfundus dar. Das Arthur Langerman Archiv für die Erforschung des visuellen Antisemitismus (ALAVA) betreut die umfangreiche Sammlung. Es wird von der Technischen Universität Berlin verwaltet und hat seinen Sitz am Zentrum für Antisemitismusforschung.
ALAVA hat Nathalie Frank mit der Entwicklung eines Konzepts sowie der künstlerischen Umsetzung einer Graphic History zu visuellem Antisemitismus beauftragt.
Der Comic wird in Form einer Ermittlung den Ursprüngen und Wirkungen dieser hasserfüllten Bilder nachspüren, ohne diese durch eine simple Reproduktion in den Vordergrund zu rücken.
Im Prolog wird die methodische Herangehensweise erläutert – und ein eigens für dieses Werk geprägter Begriff eingeführt: die „J.“. Es handelt sich dabei um ein antisemitisches Konstrukt von „Juden“: „J.“ sind keine realen Menschen, sondern imaginäre, stark kodierte, stereotypisierte, verzerrte, unangenehme Figuren. Der Begriff „J.“ erlaubt es, zwischen antisemitischen Fantasiegestalten und den realen Personen, die sie entmenschlichen sollen, scharf zu unterscheiden.
In sieben Kapiteln – den sieben Wochentagen entsprechend – stehen sieben Fragen im Mittelpunkt: Wer sind J., und wer sind Juden und Jüdinnen? Wie sind Juden und Jüdinnen zu J. geworden? Was bewirken J. im kollektiven Unterbewusstsein? Wozu dienen J.? Wem schaden J.? Wo sind die Frauen? Wann machen wir eine Pause? Die ersten sechs Tage stehen im Zeichen der Arbeit. Am siebten Tag, wie am Sabbat, hingegen ist Zeit für Muße und Entspannung mit (jiddischer) Literatur und (jüdischem) Humor. Nach dem siebten Tag beginnt alles wieder von vorne: Es wird weiter ermittelt, weil das Problem des Antisemitismus nicht „gelöst“ ist.
Um diese Fragen zu reflektieren, stützt sich Nathalie Frank in erster Linie auf die Bilder und Objekte aus der Sammlung Langerman, thematisiert aber auch die Biografie des Sammlers, das Leben der Künstler:innen, die sie entworfen haben, sowie Vordenker, Akteure und Schlüsselereignisse in der Geschichte des Antisemitismus von der Antike bis zur Gegenwart.